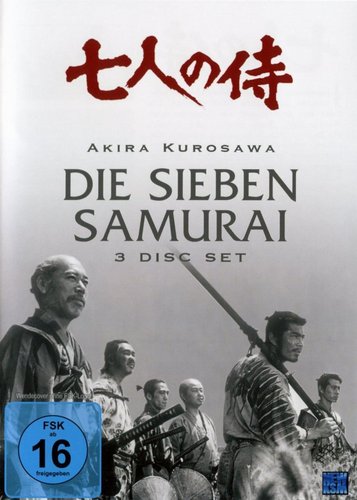Als der Fremde sich dem Hotel der Stadt nähert, treten weitere Männer auf die Straße: zwielichtige Gestalten mit unzähligen Tätowierungen, mehr Narben und schiefen Grimassen. Mindestens sechs stehen vor dem wortkargen Fremden, drei von ihnen umzingeln ihn und beginnen, Drohgebärden abzuspulen. Einer prahlt mit der Summe auf seinen Steckbriefen. Ein anderer reiht Verbrechen aneinander, als schildere er Passagen in seinem Lebenslauf.
„Dann macht es ja nichts, wenn ich euch töte“, bemerkt der einsame Fremde. Kaum eine Miene verzieht er dabei. Nur einer seiner Mundwinkel wandert einige Millimeter nach oben, von wo aus er dem wettergegerbten Gesicht ein amüsiertes Lächeln abringt. Die Gestalten weichen zurück, schweißnasse Finger tasten nervös nach den Griffen von Waffen.
„Wir sind Verbrecher, wir haben keine Angst! Versuch es nur!“
„Für Dummheit gibt es keine Heilung“, spöttelt der Fremde, als er eine seiner verkrampften Schultern auflockernd kreisen lässt.
„Nur den Tod.“
„Wir brauchen zwei Särge“, bemerkt er, als ihm der Bestatter entgegeneilt. Plötzlich ist es wieder still.
„Warte. Mach drei draus.“
Déjà-vu im Wilden Westen
Beim mysteriösen Fremden handelt es sich weder um Clint Eastwood noch um Charles Bronson, sondern um Sanjuro: den wandernden Schwertkämpfer aus Akira Kurosawas Kultfilm Yojimbo. Zwar gibt es viele Parallelen zwischen Sergio Leones Revolverhelden aus Für eine Handvoll Dollar und Kurosawas Titelfigur. Yojimbo lässt sich aber ziemlich eindeutig als Samurai-Film einordnen. Oder präziser gesagt: als Historiendrama mit Schwertkampf-Elementen.Leone hat sich – wie viele andere Western-Regisseure der 60er – stark von Fernost-Kino inspirieren lassen. Der wortkarge Revolvermann? Ein passendes Stand-in für den herrenlosen Samurai (Rōnin). Klingen statt Kugeln, Kimonos statt Ponchos, Stroh- statt Filzhüte, Sandalen statt Cowboystiefel und so weiter.
Inhaltlich gibt es – zumindest in vielen Italowestern – Themen, Tropen, Figuren und Geschichten, die sich problemlos austauschen lassen. Das zeigt auch die kleine Szenenschilderung am Anfang des Artikels. Schließlich hat niemand etwas von Pistolen, Cowboys und Saloons gesagt, oder?
Für eine Handvoll Dollar (Italien/Spanien/Deutschland 1964) © Paramount + Yojimbo - Der Leibwächter (Japan 1961) © Toho/KSM
Filmneuland
Grund genug für die Videobuster-Redaktion, einmal den Blick auf das Samurai-Genre zu werfen. Diese drei Chanbara-/Jidai-geki-Filme begeistern nicht nur Western-Fans.
1. Die sieben Samurai (Akira Kurosawa, 1954)
Ein weiterer Kurosawa-Klassiker, wieder mit enormem Einfluss auf das Western-Genre. Und nicht nur Die glorreichen Sieben greift den Plot des Historienfilms auf, um ihn nach Nordamerika zu verpflanzen. Auch Winnetou und sein Freund Old Firehand nutzen den Inhalt des monumentalen Jidai-geki als Blaupause.Abseits des Wildwest-Kinos gibt es ebenfalls zahlreiche Adaptionen der Geschichte: Disneys Das große Krabbeln, Sador – Herrscher im Weltraum, Episoden von Star Trek (Deep Space 9 und Star Trek), Star Wars - The Clone Wars. Stephen Kings Wolfsmond. Zahllose Neuverfilmungen. Selbst eine Anime-Adaption existiert.
Die sieben Samurai besetzt zuverlässig die Top 25 vieler Listen, die sich den besten Filmen aller Zeiten widmen. Sowohl einflussreiche Kritiker als auch Regisseure zählen ihn zu ihren Lieblingstiteln. Woher kommt diese positive Resonanz? Und warum stürzen sich sowohl Drehbuchautoren als auch Filmsnobs immer wieder auf die Geschichte um die sieben ungleichen Schwertkämpfer?
Die Handlung
Der Plot lässt sich schnell zusammenfassen: Die Bewohner eines Bauerndorfs bekommen mit, wie Banditen planen, sie in naher Zukunft zu überfallen. Allerdings erst nach Abschluss der Ernte. Statt blind darauf zu hoffen, dass die Räuber ihnen genug zum Überleben übriglassen, schlagen einige von ihnen vor, professionelle Hilfe anzuheuern. Mindestens sieben Samurai brauchen sie dafür, lautet das Urteil des Dorfältesten. Die Bauern heuern also eine Truppe sehr unterschiedlicher Gestalten an, die – zusammen mit den Bewohnern – das Dorf verteidigen. Ende.Das liegt nicht nur daran, dass Kurosawa zuerst da war. Auch die vielen kleinen Nuancen der „Originalfassung“ – angefangen bei den einprägsamen Charakteren – tragen ihren Teil dazu bei. Von denen gibt es nämlich eine ganze Menge. Wenigen Regisseuren gelingt es, ihren Film mit einer derart großen Gruppe von Figuren zu bevölkern, die alle einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nicht nur die Samurai – auch die Bewohner des Dorfes – bleiben im Gedächtnis.
Die Figuren
Die Schwertkämpfer stehen dabei selbstverständlich im Mittelpunkt. Jeder von ihnen lässt sich klar definieren, ohne den Eindruck eines wandelnden Stereotyps zu erwecken. Schließlich heißt der Film nicht „Die sieben Zwerge“.Einige von ihnen geben viel von sich preis, andere nicht. Die meisten von ihnen sind gefestigt, andere wollen sich noch beweisen. Manche sind sympathisch, andere geheimnisvoll. Der ein oder andere trägt sein Herz auf der Zunge. Alle inspirieren uns – trotz klaffender Mängel. Vereinzelt gibt es sogar Konfliktpotenzial. Das lässt sie plastisch wirken, wie Bekanntschaften, die uns im echten Leben begegnen könnten. Ihre Reaktionen bleiben erwartbar, aber nie zu 100 Prozent vorherzusehen.
Zum Beispiel Toshiro Mifunes Charakter Kikuchiyo. Der ähnelt dem souveränen Rōnin, den er in Yojimbo verkörpert, nämlich überhaupt nicht. Betont rüpelhaft stapft er von einem Fettnäpfchen ins andere und wirkt dabei oft selbst ein bisschen wie ein Bandit. Alles an ihm ist roh, laut und ungehobelt. Selbst seine Waffe – ein riesiges Nodachi-Schwert, das er über seiner Schulter tragen muss – schwingt der Hühne wie einen groben Knüppel herum. Vorausgesetzt, er schafft es, fünf Minuten lang nichts Dummes anzustellen.
Jeder der Samurai und viele der Dörfler lassen ähnliche Beschreibungen zu – ganz ohne irgendetwas über ihr Aussehen oder ihre Stellung preiszugeben. Sie sind Charaktere im eigentlichen Sinne des Wortes. Hier liegt eine der großen Stärken des Filmes: seine vielen greifbaren und interessanten Figuren. Und die Dynamik, die entsteht, sobald sie aufeinandertreffen.
Extras
Neben den Figuren und Dialogen überzeugt auch die Umsetzung durch Altmeister Kurosawa. Jede Szene grenzt sich deutlich ab und folgt aus der Notwendigkeit der Erzählung. Kameraeinstellungen gestaltet der Regisseur – von Schnitt zu Schnitt – wie eine eigene kleine Mini-Szene.Diese Detailverliebtheit zeigt sich auch im Szenenbild und den Kostümen. Viele Figuren spiegeln äußerlich wider, was sie innerlich ausmacht, durch kleine, unscheinbare Details. Zum Beispiel Kanbei – der Anführer der Truppe (gespielt von Takashi Shimura). Als erfahrener Soldat ist er nicht nur mit allen Wassern gewaschen, er kennt auch die Schrecken des Krieges. Seine Suche nach Ruhm ist längst vorbei. Stattdessen versucht er, das Beste aus der Situation zu machen und zu helfen, wo er kann. Das zeigt er von Anfang an, als er seinen Kopf rasiert, um ein Kind aus einer Geiselnahme zu befreien. Der Kidnapper hält ihn nämlich für einen Mönch, sodass Kanbei ihn überrumpeln kann, ohne das Kind zu gefährden. Ein Samurai würde sich nämlich niemals den Kopf rasieren (höchstens als Ausdruck großer Schande). Kanbei steht mittlerweile über diesen Dingen. Sein kahler Kopf erinnert ihn im Laufe des Films daran. Jedes Mal, wenn er sich mit der Hand über die Stirn fährt.
Auch das Dorf hat Charakter. Höchstwahrscheinlich, weil es wirklich existiert – zumindest für die Dauer des Films. Jeder Kampf und jedes Scharmützel findet also in der echten Welt statt. Zwischen dem Schlamm der Reisfelder und improvisierten Zäunen. Kein Greenscreen, keine Tricks. Umso greifbarer wirken auch die Handlungen und das, was auf dem Spiel steht.
40 % Chanbara, 60 % Jidai-geki
2. Yojimbo (Akira Kurosawa, 1961)
Weitere Filme mit Geschichten, die Yojimbo wahrscheinlich als Blaupause benutzt haben? Django (1966), Last Man Standing (1996), In den Klauen der Mafia (1976), Inferno, Omega Doom (1996) und viele weitere.
Apropos Geschichte: Worum geht es eigentlich in Yojimbo?
Die Handlung
Der herrenlose Samurai Sanjuro – möglicherweise nicht sein echter Name – hält bei seinen Reisen in einer kleinen Stadt, die von zwei rivalisierenden Banden beherrscht wird. Die Bewohner leben in ständiger Angst. Daher entschließt sich Sanjuro (gespielt von Toshiro Mifune), die Verbrecher zu bekämpfen. Allerdings nicht mit roher Gewalt. Zumindest nicht nur. Dafür sind die beiden Gruppen zu groß und zu gefährlich. Stattdessen bringt er beide Gruppen mit einer List nach der anderen gegeneinander auf, schwächt sie und kümmert sich anschließend um den letzten, der noch steht.Der Hauptcharakter
Yojimbo könnte auch als Heldensage oder Superheldenfilm durchgehen. So übermächtig, cool und gewitzt setzt Kurosawa den wandernden Rōnin in Szene. Nicht nur sein Geschick mit dem Schwert begeistert: Seine taktische Klugheit und scharfe Zunge lassen ihn geradezu übermenschlich klug erscheinen. Allerdings verhält sich Sanjuro kaum wie ein klassischer Musterknabe. An keinem Punkt entrüstet er sich moralisch über den Zustand der Stadt. Für ihn stellt sie vielmehr eine Herausforderung dar – selbst, als einige Bewohner seine Hilfe aus Angst vor weiterer Eskalation explizit ablehnen.Die Bewohner scheinen ihn die meiste Zeit über weniger zu interessieren als die Herausforderung, die ihre Stadt bietet. Diese Fassade bröckelt allerdings hin und wieder. Im Laufe des Films gibt sich der Rōnin mehrfach die Blöße und beweist sogar wahren Heldenmut. Dann hilft er genau den Bürgern der Stadt, die es am schlimmsten getroffen hat, und setzt wissentlich sein eigenes Leben aufs Spiel.
All das zeigt sich auch in Sanjuros Gesten und Eigenheiten. Einen Arm hält der Rōnin stets in seinem Kimono versteckt – um jederzeit das sprichwörtliche Ass im Ärmel zu ziehen. Manchmal ragt seine Hand aus dem Kragen. Dann kratzt sich der Samurai nachdenklich am Kinn, während er seinen nächsten Schachzug plant. Zeitweise zeigt sich auch das mittlere Alter des Schwertkämpfers. Besonders, wenn er sich vor Duellen mit einem Schulterzucken auflockert, als handele es sich um eine Runde Frühsport. Sanjuros kleine Charakter-Ticks triefen nur so vor Beiläufigkeit und Coolness.
Extras
Was den Zuschauer sonst noch bei der Stange hält? In erster Linie das taktische Hin und Her zwischen den Parteien, die Sanjuro die meiste Zeit über wie seine persönlichen Marionetten tanzen lässt. Aber auch die fantastischen Dialoge voller Sticheleien und schwarzem Humor sind seit der Uraufführung des Films kein bisschen gealtert.Kurosawa unterstützt den Inhalt des Films mit meisterhaften Schnitten und präziser Bildsprache. Jede Einstellung folgt einer Funktion, unterstützt die Handlung oder transportiert die Dynamik der Szene. Hier stimmt einfach alles – wahrscheinlich ein Grund, warum Yojimbos Kultstatus auch nach 60 Jahren fortbesteht.
80 % Chanbara, 20 % Jidai-geki
3. The Sword of Doom (Kihachi Okamoto, 1966)
Und nicht nur das: Auch Schauspieler, die der Zuschauer vor allem als gutmütige Heldenfiguren kannte, besetzten Regisseure in dieser Zeit gern als Schurken um. Henry Fonda in Spiel mir das Lied vom Tod ist sicher ein klassischer Fall. Unsere beiden ersten Filmbeispiele haben in dieser Angelegenheit ebenfalls Pionierarbeit geleistet. Nichtsdestotrotz gibt es einen Film, der diesen Paradigmenwechsel noch deutlicher ankündigt als Kihachi Okamotos Meisterwerk The Sword of Doom.
Die Handlung
Ryūnosuke Tsukue ist ohne Zweifel der stärkste Schwertkämpfer weit und breit. Aufgrund seiner kaltherzigen und brutalen Art verstößt ihn die örtliche Schwertkampfschule und lässt ihn erst wieder antreten, als es um die Nachfolge der Schulleitung geht. Der Außenseiter soll bei einem Schaukampf gegen den Samurai Bunnojo Utsugi verlieren. Das möchte auch Utsugis Ehefrau in die Wege leiten und gibt sich im Gegenzug Ryūnosuke (widerwillig) hin. Als ihr Ehemann Wind davon bekommt, sieht er rot. Während des Schaukampfes macht er blutigen Ernst, unterliegt aber Ryūnosuke, der ihn mühelos erschlägt. Der Klan des Getöteten lauert wiederum Ryūnosuke auf, während er das Dorf mit Utsugis Witwe im Schlepptau verlässt. Zwei Jahre später verdingt er sich als Auftragsmörder einer halb-offiziellen Polizeieinheit.Der Hauptcharakter
Dieser Kontrollverlust zeigt sich auf unterschiedliche Weise im Kampfverhalten Ryūnosukes. Die meiste Zeit steht er abwesend da, das Schwert gen Boden zeigend. Als wünsche er sich, dass ihn endlich jemand erwischt. Dann, sobald der Gegner angreift, schlägt er reflexartig wie eine Schlange zu. Seine Blutgier versagt ihm jedes Mal zuverlässig den Tod.
Erst zum Schluss des Films beginnt Ryūnosuke, seinen Kontrollverlust offen zu zeigen. Blutverschmiert wütet er wie eine Bestie durch den Raum und zerstört alles in seinem Weg. Dabei greift er sowohl echte als auch eingebildete Gegner an. Ryūnosuke wirkt wie ein Kollaps auf zwei Beinen. Es gibt keine Rettung für ihn und seine Natur – er kann nur beten, dass sein Leiden und das seiner Opfer nicht noch länger andauert.
Extras
Kamera, Schnitt und Kinematographie unterstützen den Inhalt des Films effektiv. Viele Einstellungen sagen etwas über Ryūnosuke oder die derzeitige Situation der Szene aus – durch ihre Komposition, die Farben und die subtile Symbolik. Zum Beispiel, wenn der Schwertkämpfer einen langen, knorrigen Waldweg entlangschreitet, der vor ihm im Nebel verschwindet. Rechts und links von ihm lauern Feinde. Ryūnosuke schlägt den Pfad wissentlich ein und steuert aktiv auf sein noch ungewisses Ende zu.
Die einzige wirkliche Schattenseite des Films? Der abrupte Schluss. Eigentlich sollten zwei weitere Teile folgen. Dazu kam es aber nie, da The Sword of Doom bei seiner Veröffentlichung alles andere als gut beim japanischen Publikum ankam. Zu brutal, zu bösartig, zu kontrovers. Die zwei geplanten Nachfolger wurden nie gedreht. Allerdings funktioniert der später zum Kultklassiker geadelte Film auch hervorragend als Einteiler. Ryūnosuke verfällt im Laufe der Handlung zunehmend dem Wahnsinn – mitten in seinem finalen Amoklauf endet der Film mit der „Ende“-Titelkarte. Eigentlich gibt es kein passenderes Schicksal für Ryūnosuke, als ihm sein eigenes Ende zu verwehren. Die Erlösung für den tragischen Charakter (und den Zuschauer) bleibt aus.
50 % Chanbara, 50 % Jidai-geki